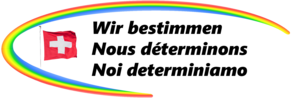Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)
(Eidg. Volksinitiative)
Die Initiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» verlangt eine Verfassungsänderung zur landwirtschaftlichen Tierhaltung. Der Bund soll die Würde des Tieres in der landwirtschaftlichen
Tierhaltung schützen. Konkret sollen Kriterien festgelegt werden für eine tierfreundliche Haltung und Pflege, den Zugang der Tiere ins Freie und die Schlachtung.
Die wichtigsten Argumente, ...
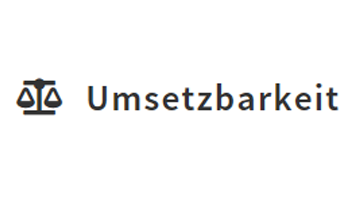
weil eine Umsetzung zu tierwohlgerechter Tierhaltung möglich ist und von 87% (Isopublic) der Bevölkerung das Tierwohl in der Landwirtschaft für “wichtig” oder “sehr wichtig” gehalten wird!
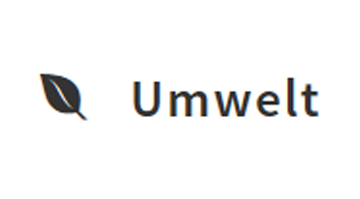
weil die Massentierhaltung die natürlichen Ressourcen der Erde sehr ineffizient nutzt und Wasser und Atmosphäre verschmutzt. Die immensen Treibhausgasemissionen und die Rodung riesiger Waldflächen sind für den Klimawandel mitverantwortlich.

weil die Massentierhaltung immenses Tierleid verursacht. Es ist heute anerkannt, dass Tiere empfindungsfähige Wesen sind. In der Massentierhaltung werden sie in grossen Gruppen auf engem Raum gehalten und ihre grundlegendsten Bedürfnisse missachtet. Besamung.
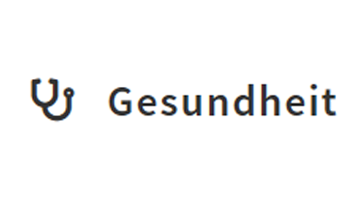
weil die Massentierhaltung der menschlichen Gesundheit schadet. In der Schweiz werden Nutztieren pro Jahr fast 50 Tonnen Antibiotika verabreicht. Multiresistente Keime sind unter Tieren weitverbreitet und können auch für den Menschen gefährlich werden. gefährden.
Argumente, Fragen und Antworten, Mythen
Die Welternährungsorganisation der UNO (Food and Agriculture Organisation, FAO) schätzt, dass die Massentierhaltung für 14,5 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Dies entspricht ungefähr den Gesamtemissionen des weltweiten Verkehrs. Das Treibhausgas Methan, das primär durch den Verdauungsprozess von Wiederkäuern wie Kühen, Ziegen und Schafen verursacht wird, ist dabei von besonderer Bedeutung. Einerseits verursacht es fast die Hälfte der Treibhausgasemissionen, die aus der Massentierhaltung resultieren. Andererseits ist seine erderwärmende Wirkung 25-mal stärker als diejenige von Kohlendioxid. Um die schlimmsten Auswirkungen der globalen Erwärmung zu verhindern, müssen die Treibhausgasemissionen ausgehend von den Emissionen im Jahr 2000 bis ins Jahr 2050 um mindestens die Hälfte reduziert werden. Die Verminderung der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und die vermehrt pflanzliche Ernährung können einen erheblichen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels leisten. Für die Schweiz haben Forscher der ETH ermittelt, dass die Verkleinerung der Tierbestände die Potenteste aller Massnahmen zur Reduktion der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen ist.
Initiativtext
Die Bundesverfassung[1] wird wie folgt geändert:
1 Der Bund schützt die Würde des Tieres in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Die Tierwürde umfasst den Anspruch, nicht in Massentierhaltung zu leben.
2 Massentierhaltung bezeichnet die industrielle Tierhaltung zur möglichst effizienten Gewinnung tierischer Erzeugnisse, bei der das Tierwohl systematisch verletzt wird.
3 Der Bund legt Kriterien insbesondere für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, den Zugang ins Freie, die Schlachtung und die maximale Gruppengrösse je Stall fest.
4 Er erlässt Vorschriften über die Einfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen zu Ernährungszwecken, die diesem Artikel Rechnung tragen.
Art. 197 Ziff. 12[2]
12. Übergangsbestimmungen zu Art. 80a (Landwirtschaftliche Tierhaltung)
1 Die Ausführungsbestimmungen zur landwirtschaftlichen Tierhaltung gemäss Artikel 80a können Übergangsfristen von maximal 25 Jahren vorsehen.
2 Die Ausführungsgesetzgebung muss bezüglich Würde des Tiers Anforderungen festlegen, die mindestens den Anforderungen der Bio-Suisse-Richtlinien 2018[3] entsprechen.
3 Ist die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 80a nach dessen Annahme nicht innert drei Jahren in Kraft getreten, so erlässt der Bundesrat Ausführungsbestimmungen vorübergehend auf dem Verordnungsweg.
Im Bundesblatt veröffentlicht: 12.06.2018
Eingereicht am : 17.09.2019
Ablauf der Sammelfrist: 12.12.2019
Diese Initiative wurde lanciert von folgenden Komitee-Mitgliedern (nach Alphabet Nachname):

Brunner Gabrielle, Basel
(Web-Seite)

Erig Noëmi, Zürich
(Web-Seite)

Frei Marcela, Waldkirch
(Web-Seite)

Girod Bastien, Zürich
(Web-Seite)

Graber Nadja, Basel
(Web-Seite)

Gröbly Thomas, Baden
(Web-Seite)

Heiligtag Sarah, Egg
(Web-Seite)

Hofer Verena, Nürensdorf
(Web-Seite)

Hoppen Philipp, Bern
(Web-Seite)

Huber Hans-Ulrich, Altikon
(Web-Seite)

Labhardt Pablo, Zürich
(Web-Seite)

Mändli Ivo, Zürich
(Web-Seite)

Marmy Adrian, Basel
(Web-Seite)

Müller Céline, Luzern
(Web-Seite)

Neuburger Raphael, Zürich
(Web-Seite)

Rösner Kim, Zürich
(Web-Seite)

Ryf Philipp, Zürich
(Web-Seite)

Salzgeber Valentin, Basel
(Web-Seite)

Schneider Meret, Uster
(Web-Seite)

Stadelmann Mike, Zürich
(Web-Seite)

Stoykova Katerina, Zürich
(Web-Seite)

Truffer Fabien, Vevey
(Web-Seite)

Walther Reto, Zürich
(Web-Seite)

Weber Vera, Bern
(Web-Seite)

Wenk Yasmine, Schmerikon
(Web-Seite)

Wild Markus, Zeglingen
(Web-Seite)