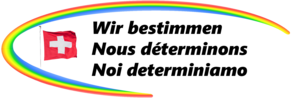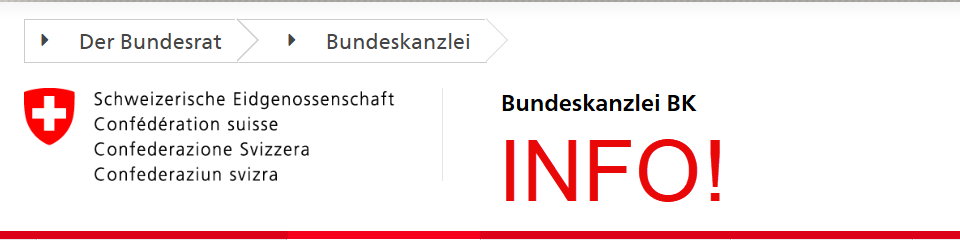Eidgenössische Volksabstimmungen
Nächste eidgenössische Volksabstimmung: 28. September 2025
Ein fakultatives Referendum ist das politische Recht der Bevölkerung, direkt über Entscheidungen des Parlaments mitzubestimmen. Wenn das Parlament ein neues Gesetz verabschiedet, können Bürgerinnen und Bürger verlangen, dass dieses nicht sofort in Kraft tritt, sondern zuerst vom Volk beurteilt wird. Damit ein solches "fakultatives" Referendum zustande kommt, müssen innerhalb von 100 Tagen nach der Veröffentlichung des Gesetzes mindestens 50’000 Stimmberechtigte ihre Unterschrift leisten. Kommt die nötige Anzahl zusammen, entscheidet die Stimmbevölkerung in einer Volksabstimmung, ob das Gesetz angenommen oder abgelehnt wird.
Eidgenössisches Referendum
Die Referendumsinitiativen gegen die E-ID (elektronische Identität) in der Schweiz richten sich gegen das neue Bundesgesetz über die elektronische Identität.
Die Gegner des Gesetzes zur Elektronischen Identität (E-ID) bringen einige Nachteile zur Sprache, die kritisch betrachtet werden sollen:
- Risiken für den Datenschutz:
Persönliche Daten könnten missbraucht oder unzureichend geschützt werden.
- Abhängigkeit von Technologie
Bürgerinnen und Bürger wären stark auf digitale Systeme und Anbieter angewiesen.
- Vertrauensprobleme und Überwachungstendenzen
Es besteht die Sorge vor staatlicher oder privater Kontrolle.
- Digitale Ungleichheiten
Nicht alle Menschen haben denselben Zugang zu digitalen Lösungen.
- Zwang oder schleichende Verpflichtung
Die Nutzung einer E-ID könnte langfristig kaum mehr umgangen werden.
- Kosten und Bürokratie
Die Einführung verursacht zusätzliche Ausgaben und Verwaltungsaufwand.
(weitere Informationen der Gegner und der Befürworter des Gesetzes hier...)
Chronologie:
siehe Seite Bundeskanzlei
Ein obligatorisches Referendum bedeutet, dass bestimmte Vorlagen zwingend dem Volk und den Kantonen zur Abstimmung vorgelegt werden. Dies ist vor allem bei Änderungen der Bundesverfassung, beim Beitritt zu supranationalen Organisationen oder bei dringlichen Bundesgesetzen mit längerer Geltungsdauer der Fall. Damit eine Vorlage angenommen wird, braucht es das doppelte Mehr: die Mehrheit aller gültigen Stimmen des Stimmvolks sowie die Mehrheit der Kantone. Beim obligatorischen Referendum entscheiden somit immer sowohl die Bevölkerung als auch die Kantone gemeinsam.
Eidgenössische Volksabstimmung
Der Bundesrat und das Parlament verfolgen mit dieser Vorlage ein ausgewogenes Reformkonzept: Sie wollen das Steuersystem vereinfachen und das Wohneigentum entlasten durch die Abschaffung des Eigenmietwerts – gleichzeitig aber die Kantone, insbesondere diejenigen mit hohen Zweitwohnungsquoten, vor Einnahmeverlusten schützen, indem sie ihnen die Einführung einer Zweitliegenschaftssteuer ermöglichen. Beide Elemente sind verknüpft und bilden eine systematische Reform, die nun vom Volk und den Ständen entschieden werden muss.
Ziele und erwartete Vorteile von Bund und Kantonen mit dieser Vorlage:
- Vereinfachung des Steuersystems
Wegfall des Eigenmietwerts macht die Besteuerung von Wohneigentum verständlicher und transparenter.
- Gerechtigkeit zwischen Mietern und Eigentümern
Eigenmietwert wird oft als "fiktive Steuer" empfunden, seine Abschaffung beseitigt eine Ungleichbehandlung.
- Entlastung von Erstwohnungsbesitzer
Eigentümer, die ihr Eigenheim selber bewohnen, werden finanziell direkt entlastet.
- Stabile Einnahmen für Kantone mit Zweitwohnungen
Durch die neue Zweitliegenschaftssteuer können Einnahmeausfälle kompensiert werden.
- Flexibilität für Kantone
Jeder Kanton kann selber entscheiden, ob und wie er die Zweitliegenschaftssteuer erhebt.
- Fiskalische Nachhaltigkeit
Die Kombination aus Entlastung und neuen Einnahmequellen soll die Steuerbasis langfristig sichern.
(weitere Informationen der Gegner und der Befürworter des Gesetzes hier...)
Chronologie:
siehe Seite Bundeskanzlei